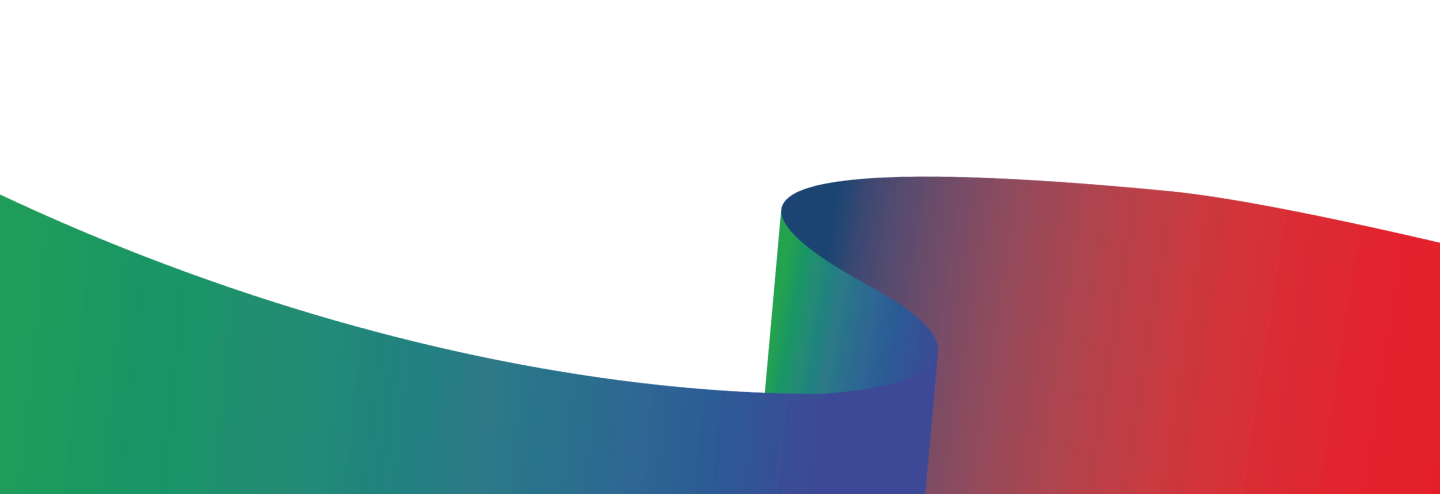Deutschland und die Vereinigten Staaten sind als langjährige Innovationspartner in einer einzigartigen Position, diese Entwicklung gemeinsam voranzutreiben. Nordrhein-Westfalen (NRW) bietet mit seiner hohen Dichte an „Hidden Champions“ und einem starken Mittelstand zudem einen besonders fruchtbaren Boden für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. In diesem Kontext kamen Expertinnen und Experten zusammen, um über den Status quo und die Zukunftsperspektiven von KI zu diskutieren. Die Podiumsteilnehmenden diskutierten über ideale Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für KI-Projekte – ebenso wie über bestehende Hürden und neue Chancen. Zentrale Frage war: Wie werden sich die aktuellen transatlantischen Spannungen langfristig auf die Nutzung von KI auswirken?
NRW – Deutschlands industrielles Powerhouse ist bereit für KI
NRW ist führend bei Exporten und industrieller Wertschöpfung – und damit ein wesentlicher Motor der deutschen wie auch europäischen Wirtschaft. Als bevölkerungsreichstes Bundesland und industrielles Herz Deutschlands beheimatet NRW zahlreiche „Hidden Champions“ und einen besonders starken Mittelstand. Diese kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), bekannt für langfristiges Denken, technologische Exzellenz und starke regionale Verankerung, sind in ihren Nischenmärkten oftmals Weltspitze – etwa Phoenix Contact (Industrieautomatisierung), GEA Group (Prozesstechnik) oder Vorwerk (Haushaltsgeräte).
Diese hochspezialisierten, global wettbewerbsfähigen Unternehmen können durch KI-gesteuerte Lösungen massiv profitieren – sei es durch Effizienzsteigerung, vorausschauende Wartung oder individualisierte Prozesse. Durch den gezielten Einsatz von KI lassen sich Marktpositionen stärken, technologische Führungsrollen festigen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext sichern. In Zeiten geopolitischer Spannungen kann KI zudem helfen, Störungen frühzeitig zu erkennen, Logistik in Echtzeit neu auszurichten oder Energienetze effizienter auszubalancieren.
Daten als Weg, nicht als Ziel
Ein wiederkehrender Tenor unter den Expert:innen: Daten entstehen nicht perfekt – sie werden iterativ aufgebaut. KI-Projekte entfalten ihr Potenzial und bringen einen echten Return-on-Investment, wenn sie mit hochwertigen, kontextreichen Datensätzen arbeiten, die gemeinsam mit dem Projekt reifen. Datenmanagement wird dabei zur tragenden Säule und erfordert kontinuierliche Sorgfalt bei der Datenqualität.
Hinzu kommt: Erfolgreiche KI-Initiativen basieren selten auf „Moonshots“, sondern auf kleinen, kontinuierlichen Fortschritten. Wie Mark Rickmeier, CEO von TXI Digital, betonte, erscheinen gute Daten kaum je in fertiger Form. Oft starten Projekte mit eng umrissenen Herausforderungen – etwa der automatisierten Verfolgung von Eisenbahnwaggons, die bislang manuell erfasst wurde – und entwickeln sich weiter, sobald bessere Daten zur Verfügung stehen. Der Schlüssel liegt in iterativer Entwicklung und einer Lernkultur, die Fehler als Teil des Fortschritts begreift.
Smart Manufacturing nicht aus dem Blick verlieren
Trotz aller Euphorie rund um KI ist sie nicht immer die beste Lösung für Herausforderungen in der Fertigung – so Franz Ernst, CIO und Experte für intelligente Fertigungssysteme in der Chemie-, Pharma- und Automobilindustrie. Die Faszination für neue Technologien kann dazu führen, die bereits bewährte Effektivität smarter Produktionssysteme zu übersehen, die mit Automatisierung, Prozessoptimierung und datenbasierter Entscheidungsfindung exzellente Ergebnisse liefern.
KI-Projekte hingegen sind oft ressourcenintensiv – sie erfordern robuste Dateninfrastrukturen, spezialisiertes Personal und Zeit, ohne Erfolgsgarantie. Ist der zugrunde liegende Prozess nicht ausgereift oder das Anwendungsszenario unklar, kann KI zur teuren Sackgasse werden. In vielen Fällen lohnt es sich, bestehende Systeme zu verbessern, bevor man neue Technologien einführt.
Better Together
Die industrielle Stärke und das technische Know-how Deutschlands, kombiniert mit der führenden KI-Infrastruktur und dem Wagniskapital der USA, schaffen ideale Voraussetzungen, um vielversprechende Anwendungsfelder zu identifizieren. Deutsche Fabriken bieten realitätsnahe, komplexe Umgebungen, in denen KI-Lösungen aus den USA getestet, angepasst und skaliert werden können. Umgekehrt profitieren US-Entwickler von deutscher Präzision und Ingenieurskunst, wenn es um die Anforderungen an KI-gestützte Systeme geht.
Andy Annacone, Managing Director von TechNexus, unterstrich die Bedeutung grenzüberschreitender Innovationsinitiativen. Wenn regulatorische Rahmenbedingungen aufeinander abgestimmt sind, fließen Kapital und Ideen deutlich freier. Auch die unterschiedlichen Innovationskulturen spielen dabei eine Rolle: Während in Deutschland Konsens, erprobte Ergebnisse und Risikominimierung im Fokus stehen, setzen die USA stärker auf Experimentierfreude und Lernen durch Fehler. Eine kluge Kombination beider Ansätze kann enormes Potenzial freisetzen.
Das Panel betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen transatlantischen Governance-Rahmens für KI – insbesondere bei sicherheitskritischen Anwendungen wie autonomen Produktionslinien. Gegenseitige Konformitätsprüfungen könnten hier grenzüberschreitende Normen vereinfachen. Gemeinsame Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in nachhaltige Prozesse stärken langfristig Resilienz und Innovationsfähigkeit auf beiden Seiten des Atlantiks.
Auch ohne aktive Beteiligung der US-Bundesregierung bleibt das Potenzial für eine enge KI-Zusammenarbeit groß – etwa durch kontinuierlichen Austausch von Ingenieur:innen, Jurist:innen, Delegationen, Bundesstaaten oder Clustern. So entsteht eine informelle Wissensbasis, die langfristig gemeinsame Standards und eine vertrauensvolle Partnerschaft ermöglichen kann.